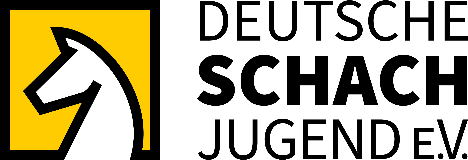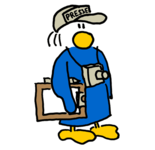Im vierten und letzten Teil unserer Serie "Das neue DSB-Präsidium im Interview" stellt sich heute Uwe Pfenning, Vizepräsident Verbandsentwicklung des DSB, unseren Fragen.
Was sind die Ziele und Zukunftsthemen im deutschen Schachsport, was wollen Sie erreichen und welche Maßnahmen nehmen Sie dazu zuerst in Angriff?
Gute Frage zu Beginn! Aber schwer in der Kürze zu beantworten. Die Ziele müssen gemeinsam bestimmt werden und alle unterliegen dem Diktat was finanziell möglich ist. Nachfolgend kommen meine Ansichten zum Ausdruck, das Präsidium wird im Spätsommer im Rahmen einer Klausursitzung sich abstimmen. Ein Pluralismus von Meinungen ist wichtig.
Priorität hat die Förderung des Schachspiels in allen Bereichen, von Schulen bis zum Altersheim in Verbindung mit den didaktischen, therapeutischen und entwicklungspsychologischen Vorteilen des Schachspiels. Damit legitimieren wir Schach als Bildungsaufgabe und als Massensport. Danach muss zwingend ein Konzept folgen, dass diese Bereich des Schachspielens an den Schachsport in den Vereinen und Verbänden andockt. Das ist eine Kunst für sich, zumal es kein Patentrezept gibt. Aus der Vielzahl der Modell- und Pilotprojekte gilt es die Effekte zu evaluieren, auch wissenschaftlich (sh. Frage 4), um dann auf fundierter Basis eine Best Practice zu verbreiten und zu fördern.
In welchen Bereichen muss sich der DSB verändern, um die Herausforderungen der Zukunft (Demografischer Wandel, Vereinssterben, Mitgliederschwund, neue Schulformen, andere Freizeitausgestaltung, verändertes Zeitmanagement junger Menschen, Gewinnung von Ehrenamtlichen, Integration, Inklusion, Frauenschach, …) zu meistern und wie sollte das der DSB Ihrer Meinung nach tun?
Weniger Formalismus und weniger Bürokratie, sondern stattdessen mehr inhaltliche Diskussion um Konzepte und Inhalte! Eine bessere Anerkennungskultur fände ich gut und weniger Eigensinn und Ehrgeiz, sondern ein Mehr an gemeinsamen Denken über die Futternäpfe (Haushalt) und Tellerränder (Einzelziele) hinaus. Der Umgangsstil muss sich signifikant verbessern! Herbert Bastian wurde in vielen Punkten persönlich polemisch angegriffen, das fand ich beschämend und war der Anlass für meine Kandidatur.
Frauenförderung steht zuvörderst an, weil mir sehen, wie viele junge Mädchen in den Schulschach-AGs sich für das Schachspielen interessieren, dann aber verloren gehen. Mono-edukative Ansätze sind eine der valide geprüften Ansätze hier Veränderungen hin zu mehr Frauen im Schach erfolgreich umzusetzen. Inklusion liegt mir, auch im familiären Kontext, sehr am Herzen und ist zugleich eine der großen Benefits des Schachsports, die andere, körperbetonte Sportarten nicht haben. Wir müssen uns aber vor positiven Diskriminierungen hüten, d.h. die Behinderten Schachspieler möchten gerne an allgemeinen Turnieren teilnehmen. Deshalb gilt es, dies zu fördern, u.a. auch durch Auflagen für Turniere behindertengerechte Örtlichkeiten anzubieten. Ich habe größten Respekt vor unserem Schachfreunden, die trotz solcher Handicaps an Turnieren teilnehmen (z.B. in Deizisau) und sehe immer wieder mit Bestürzung wie dies in der Berichterstattung und Bildern ausgeklammert wird. Dies möchte und werde ich ändern!
Welchen gesellschaftliche Verantwortungen muss der DSB in Zukunft nachkommen, bzw. kommt er heute schon nach?
Zwei Fragen in einer Frage nett verpackt, aber journalistisch eine Todsünde (§;-). Der DSB muss als Teil des DOSB seiner gesellschaftlichen Verantwortung zur Förderung des Schachspiels nachkommen. Leicht gesagt, schwer umgesetzt, weil es auch gilt die Vereins- und Verbandsegoismen hin zu dieser Leistung für die Gesellschaft, die dem DSB ja auch beträchtlich aus Steuergeldern finanziert, zu gewinnen, bei zugleich abnehmenden ehrenamtlichen Engagement. Mal sehen, was wir und anderen dazu noch einfällt? In den Schulschach-AGs leisten viele Schachfreunde dies aber schon, aber oftmals unter dem Fokus, Jugendliche als Vereinsmitglieder zu gewinnen. Viel besser ist das Konzept der Schulschach-Stiftung und des Vereins Kinderschach in Deutschland oder das Modell der SG Tegernsee, der Karpov-Akademie und der Öffnung der Talentstützpunkte wie z.B. erfolgreich in Stuttgart bei Konrad Müller umgesetzt. Wir haben also bereits einiges vorzuweisen, müssen es nur zusammenfügen und unterstützen.
Wie muss es aus Ihrer Sicht beim Thema Fairplay und Anti-Doping weiter gehen?
Indem jeder sich diesen prinzipiellen sportlichen Verhalten anschließt und danach handelt, im Spiel. Im Verband, im Umgang miteinander. E-Doping usw. greift leider um sich, wenngleich die Einzelfälle medial sehr aufgebauscht werden. Die Regelwerke reichen aus, die Sanktionen ebenso, es geht letztlich um die individuelle Verantwortung.
Nun zum Bereich der die deutsche Schachjugend betrifft:
Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten sehen Sie heute und zukünftig bei der DSJ?
Die DSJ ist Teil des DSB, gottseidank ein sehr aktiver Teil. Daraus erwachsen Ansprüche an Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Die DSJ sehe ich einerseits in der Verantwortung für die Förderung des Schachspiels in allen Varianten und in allen gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen der Jugendarbeit und Sozialisation. In Baden wird z.B. derzeit ein Schach-Rap-Hip-Hop komponiert und als Werbevideo gedreht. Andererseits gilt es im Leistungsbereich des Schachsports diesen attraktiv für unsere jugendlichen Mitglieder zu gestalten. Dazu zählen gesellige Events und die Generierung einer Gruppenidentität und Gemeinsamkeitsgefühls. Und dann gilt es eben ganz verbandlich die Deutschen Jugendmeisterschaften in allen Einzel- und Teamdisziplinen zu organisieren. Das ist eine Mammutaufgabe.
Wo macht die DSJ heute einen guten Job und wo muss Sie aus Ihrer Sicht in Zukunft besser werden?
Sie macht m.E. einen sehr guten Job im Bereich der Schachsportförderung durch didaktische Medien (z-B. Methodenkoffer 2.0-4.0), beim Einwerben von Mitteln und bei den Ansätzen der Vereinsmitsprache (Vereinskonferenzen), einen guten Job im Bereich der Organisation der Jugendmeisterschaften, wobei ich mir mehr Mitbestimmung der Eltern bei Wahl der Unterkünften und Jugendaltersklassen (U8-Meisterschaften) wünschen würde (deshalb nur ein „gut“). Defizite sehe ich im Selbstverständnis (Abgrenzungen und Redundanzen zu Aktivitäten des DSB) und einer offenen Diskussion aller Jugendkonzepte und den daraus abgeleiteten realen Fördermaßnahmen. Eine zentrale Frage dabei ist, ab wann (U8?) und wie (DWZ?) soll der „Leistungsgedanke“ eingebracht werden? Ebenso: Wie können soziale Kompetenzen parallel zur schachlichen Qualifikation aufgebaut werden?
Die Eigenständigkeit (in finanzieller und organisatorischer Sicht) der deutschen Schachjugend wird immer wieder und gerade aktuell diskutiert? Sind Sie dafür, dass die DSJ ihre Eigenständigkeit behält? Ja oder Nein? Mit welchen Argumenten stützen Sie Ihre Aussage?
Das klingt nach Fangfrage (§;-)? Aber spielen wir einmal Fang den Hut bzw. die DSJ. Eigenständigkeit ist ein hohes Gut. Viele der Landesjugendverbände haben diese z.B. nicht, nur der Dachverband. Es wäre unsinnig innerhalb eines Verbandes einen Verband zu unterhalten. Die DSJ ist eigenständig in dem Sinne der ihr übertragenen Aufgaben durch den DSB. Dazu bedarf es, um Redundanz zu vermeiden, eines ständigen kommunikativen Austausches; mehr Zusammenarbeit und mehr Abstimmung. Dazu ist die DSJ im Präsidium vertreten und macht dies - nach erstem Eindruck - auch sehr gut. Die Diskussion um die Eigenständigkeit sollte durch eine gemeinsame Konvention zu gemeinsamen und delegierten Aufgaben final geregelt werden, so dass sich alle auf das Gemeinsame konzentrieren können: Mehr Schach unter allen Dächern.
Die DEM der Schachjugend ist das größte Jugendschachevent in Deutschland. Mehr als 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind dabei. Es ist Breitenschach und Spitzensport zugleich. Gleichzeitig auch der größte Posten im Haushalt der DSJ, wie sehen Sie dieses Event? Und wie sollte es sich aus Ihrer Sicht in Zukunft entwickeln?
Nun denn; Ich habe schon Schulpokalfinale mit mehr als 1000 Spieler/innen erlebt und genossen. Wunderbar, so viele Jugendliche an Schachbrettern zu sehen. Geht weg von diesen Denken in Wettbewerbsstrukturen (wer hat mehr Jugendliche wo an welchen Brettern?). Die DEM ist ein Glanzpunkt, dem DSB und DSJ gemeinsam bestreiten sollen zur eigenen Darstellung und Werbung Es regt sich allerdings Kritik der Eltern an den zunehmend hohen Kosten und Belegpflichten. Im Sinne einer Demokratisierung des Verbandes sollte dieses Meinungsbild der Eltern validiert und gehört werden und auch in Konsequenzen münden. Man könnte z.B. mal eine Umfrage unter den „teilnehmenden“ Eltern machen? Ich bin gerne bereit dazu meine sozialwissenschaftlichen Kenntnisse einzubringen. Das Problem ist die Vergabe der DEM, nicht ihr großartiges Format.
Wie soll es Ihrer Meinung nach mit der DEM der Erwachsenen weitergehen? Kann der DSB hier etwas von der DSJ lernen?
Man kann immer etwas voneinander lernen. Die DEM leidet unter dem scheinbaren Mangel, dass die besten Spieler/innen kaum daran teilnehmen. Das ist Folge einer Wahrnehmung in der ELO und Preisgeldhöhe die zentralen Entscheidungskriterien werden. Falsch! Stimmung, Spiel und Spaß und Verantwortung gegenüber dem Verband zählen ebenso dazu. Alle heutigen Spitzenspieler/innen haben vom Verband sehr viel ideelle und finanzielle Förderung erhalten. Der Verband kann zu Recht ihre Teilnahme an der DEM einfordern, ggf. kann dies auch vertraglich in den Förderverträgen geregelt werden. Besser wäre aber die gezeigte Solidarität mit dem Verband durch eine Teilnahme. Wir sind m.E. hier zu defensiv.
Welche Worte möchten Sie den Kindern, Jugendlichen und Junioren (U25) auf der DEM in Willingen mit auf den Weg geben?
Habt zuallererst Spaß am Schach! Bleibt fair miteinander, zollt Euren Mitspieler/innen Respekt! Lasst das Schachspielen nicht zu seinem sterilen Gegeneinander-Am-Brett-Sitzen verkommen, redet miteinander und tauscht Eure Erfahrungen aus. Seid stolz auf verlorene Partien, in denen ihr gegen Stärkere Gegner gut mitgehalten habt und freut sich über verdiente wie glückliche Siege. Und bitte bedenkt, dass die DEM nur dadurch möglich, dass in vielen Vereinen und bei der DSJ so viele ehrenamtlich Engagierte sind.
Nun einige Fragen zu Ihrem Verantwortungsbereich und zu Ihrer Person:
Hr. Pfenning, auf eingen Seiten war nun der Titel Prof. und auf einigen der Titel Dr. Uwe Pfenning zu lesen. Was ist nun richtig?
Der Doktortitel ist in Wirtschaftswissenschaften (1993), der Professorentitel (2012) in Sozial- und Geisteswissenschaften, das Diplom (1988) ist in Volkswirtschaft und Soziologie. Deshalb hängt es wohl vom Alter der Webseite und der Veranstaltung ab? Das ist Teil meiner Lebensphilosophie: Inter- und transdisziplinär, immer weiterlernen und neugierig sein auf Neues. Aber Titel sind Schall und Rauch, wer mich näher kennt, weiß dass ich diese nicht vor mir her trage. Aber klar: schön sind sie schon (§;-), weil man damit in der formalen wissenschaftlichen Karriere alles erreicht hat. Sie sind aber keine Garantie für Spaß am Job.
Hr. Pfenning, als Präsident des badischen Landesverbandes haben Sie ihre eigene Schachjugend, die württembergische Schachjugend und den württembergischen Verband beim DSB Schiedsgericht angeklagt. Warum und mit welchem Ziel?
Angeklagt ist ein hartes Begriff. Die Gerichtsbarkeit des DSB ist kein formales Gericht, sondern eher Schiedsstelle. Es ging mir um kritische Aspekte der Instrumentalisierung von Verbandsfunktionen zum Ausfechten persönlicher Vorbehalte und um dem Versuch die Badische Schachjugend von der Förderung bzw. Übernahme des Konzeptes des Talentstützpunktes (TSP) Stuttgart abzuhalten, bevor überhaupt die offene Diskussion darüber begann! Es ist eine unsägliche Situation, wenn Menschen, die wichtige Verbandsfunktionen begleiten, nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander, und zwar negativ, reden. Allerdings hatte ich einerseits die Sprengwirkung eines solchen Verfahrens unter- wie auch die Stellungnahme des BSG überschätzt. Das Verfahren wurde nämlich nicht eingeleitet, u.a. weil die Schachjugend nicht selbständig sind, d.h. ich habe letztlich gegen meinen eigenen Verband geklagt (§;-). Zudem wurde keine Strittigkeit gesehen. Die Entscheidung des BSG war korrekt, salomonisch und ihr gebührt der nötige Respekt und Dank für die Mühe der Satzungslektüre. Nur haben die Kontrahenten bis heute immer noch nicht zusammengefunden. Natürlich wären hier alle Seiten zu hören. Dies ist meine Sicht der Dinge: Es ging aus wie beim Hornberger Schießen.
Bei Ihnen im Landesverband stehen im nächsten Monat ebenfalls Wahlen an. Wie sehen Sie Ihre Zukunft in Baden und was sind dort Ihre Ziele?
Ei, ja Wahlen stehen an. Die Zukunft von Baden sehe ich rosig, wir verjüngen ins mit ehemaligen Aktiven der Bad. Schachjugend (SJB), haben eine gute und offene Umgangskultur, eine feminine Trias an der Spitze der SJB, sind also in der Frauenförderung schon weiter als nur im Spielerinnenbereich. Kristin (Wodzinski) ist eine Schachheilige. Elli ist bei uns Schachbotschafterin. Kummer bereiten die schwachen Teilnehmerzahlen bei den Badischen Meisterschaften. Unsere Spielkultur ändert sich, darauf waren wir zu wenig bis gar nicht vorbereitet. Wir lernen eben immer dazu (§;-). Ich werde nochmals für drei Jahre kandidieren, hier stehe ich im Wort, obwohl ich mehrfache Funktionen im Verband eher ablehne und gerne teile und delegiere
In Ihren Bereich beim DSB fallen die Punkte Breitensport, Öffentlichkeitsarbeit und Verbandsentwicklung und vieles mehr. Was verbirgt sich hinter „und vieles mehr“?
Gute Frage, ich suche es auch noch. Aber B-Ö- V sind schon genug an Aufgaben, Ich wäre froh, diese genügend ausfüllen zu können. Es ist eine Querschnittsaufgabe und in der Geschäftsstelle steht hier ein eingespieltes Team um Heike und Louisa Nitzsche zur Verfügung. Zuerst möchte ich mit den Mitarbeiter/innen sprechen und ich austauschen. Hierfür bitte ich um Verständnis.
Hr. Woltmann hat mit der neuen Homepage oder dem Facebookauftritt viel bewegt. Welche Projekte gehen Sie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft an?
Michael Woltmann hat inhaltlich gute Arbeit geleistet. Sein Verzicht ist ein Verlust für den DSB. Der moderne Internetauftritt und die Einbindung der neuen Social Media macht den DSB im Auftritt moderner, wenngleich die Strukturen dahinter noch sehr konservativ bis bieder erscheinen. Die ersten konkreten Projekte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sollten - unter dem Haushaltsvorbehalt – für die Jugend die Einbindung kultureller Aspekte des Schachsports sein. Vielleicht mag sich die DSJ ja am Schach-Rap-Hip-Hop beteiligen, Herr Karthaus (§;-)? Dann geht es um die Intensivierung der Medienkontakte und Aufbau eines Netzwerkes, zudem hat der DSB wohl keinen Flyer zur eigenen Darstellung, z.B. für Sponsoren. Daraus kann man schöne Wettbewerbe im Verband machen. Im Bereich Senioren möchte ich gerne die Digitalisierung der Archive und historischer Materialien vorantreiben, es gilt auch noch so manche Geschichte, auch zwischen 1933-1945 aufzuarbeiten. Das könnten Schulprojekte werden. Der Platz reicht nicht aus für die Ideen.
Warum haben Sie einen Antrag auf Vergrößerung des Präsidiums gestellt und ihn später auf dem Bundeskongress wieder zurückgezogen?
Weil er im Vorfeld als nicht mehrheitsfähig vermittelt wurde und formale Schwächen hatte. Außerdem war der Bundeskongress zum Zeitpunkt der Antragsberatung außer Rand und Band und die Delegierten wollten nach über 7 Stunden Beratung Schluss machen (mit der TO). Eine sachliche Debatte erschien mir kaum noch möglich. Zudem ging es nicht um den Beschluss zur Erweiterung, sondern um die Diskussion darüber, weil es meinem demokratischen Selbstverständnis entspricht die Beteiligten einzubinden und zu fragen, ob sie diese Rolle überhaupt wollen. Der AK LV z. B. hat sich dagegen entschieden, Stimmrecht im Präsidium haben zu wollen. Der Antrag ist jetzt ein Arbeitsauftrag für das Präsidium. Er kommt als konkrete Vorlage nach eingehender interner und offener Diskussion mit allem Beteiligten wieder auf’s Tablett – versprochen. Da bleibe ich mir treu, wie auch beim Antrag Frauenförderung, der mir persönlich eher sogar wichtiger war.
Wie soll sich der Breitensportbereich weiterentwickeln? Wie wollen Sie mehr Menschen zum Schachspielen im Verein bringen?
Das ist eine gute Frage! Mit Euch und allen gemeinsam. Schulschach und Amateurschach fördern, wo immer möglich, u.a. durch Bewerbung und Verbreitung des Methodenkoffers, Schulschachpatent und staatlich anerkannte Lehrerfortbildung, Schachfestivals (wie z.B. in den Bahnhöfen in Leipzig und Berlin oder dem Rhein-Neckar-Schachfestival). Es spielen ca. 6-8 Millionen Menschen Amateurschach (fehlt in keiner Spielesammlung). Ihnen sollten wir vermitteln, wie man/frau bei Interesse das Schach vertiefen und erlernen kann bis hin zum Verein. Ideal wären Modellprojekte mit Volkshochschulen und in Altersheimen (Modellprojekt in Buchen). Mal schauen, was geht! Die DSAM und der Deutschland-Cup bin hin zu den Familienmeisterschaften sind alles Mosaiksteine in diesem Puzzle, die zugleich Erfolgsgeschichten sind. Dank an alle, die daran mitgewirkt haben. Die strategischen Kooperationen mit der Schulschach-Stiftung und dem Verein Kinderschach scheinen auch auf dem Weg zur Erfolgsgeschichte zu sein. Fortsetzung folgt!
Ein geplantes Projekt Ihres Vorgängers Herr Woltmann war die Vereinshilfe und Vereinsberatung ähnlich dem DFB weiter voranzubringen. Verfolgen Sie dieses Projekt weiter oder konzentrieren Sie sich auf andere Punkte?
Ich komme sehr gerne auf das Angebot von Michael Woltmann zurück, seine Ideen und Konzepte gemeinsam fortzuführen und weiterzuentwickeln. Es wäre prima, wenn er hier weiter- und mitmachen würde. Die Tür ist offen. Ich vereinnahme auch nicht die Ideen anderer, sondern es gilt: Ehre wem Ehre gebührt. Die Anbindung der Vereine an den DSB ist sehr wichtig (derzeit sind nur die Landesverbände Mitglieder des DSB). Das Konzept der DSJ zu den Vereinskonferenzen würde ich hierzu gerne übernehmen. Mit den Kultusministerien gilt es zu verhandeln zur Einführung von Schach als Wahlfach an Schulen. Dazu müssen aber viele Voraussetzungen intern geschaffen werden.
Was ist Ihre Zielvorstellung, wohin wollen Sie den Verband langfristig entwickeln und wie wollen Sie das erreichen?
Ich möchte den DSB sehr gerne demokratisieren, modernisieren und „humorisieren“ ($;-). Demokratisieren heißt unsere Gremien auf die Beteiligung der betroffenen Klientel zu trainieren (Eltern, Kinder, Schüler, Lehrkräfte, Trainer), weniger einsame Entscheidungen von Funktionsträgern nach eigenen Gutdünken. Modernisieren heißt mehr Diskutieren, und zwar fundiert und gründlich, über die inhaltlichen Schwerpunkte der Mädchen- und Frauenförderung, Seniorenschach und Werbung, attraktive Turnier- und Spielformate, Kooperationen Schule und Kitas u.a. Ich hoffe hier von meinen wissenschaftlichen Netzwerken und Gutachteraufgaben für den DSB profitieren zu können (z.B. Projekt Stiftung Haus der kleinen Forscher, Drittmittelprojekte)
Was machen Sie, wenn Sie nicht Vizepräsident Verbandsentwicklung beim DSB sind?
Leben! U.a. Radfahren, Bergsteigen und Wandern, etwas Politik, Tibethilfe, Schachspielen (ELO anheben), Musizieren (Gitarre u.a.) und Musik hören, Nachdenken.
Ich glaube viele Personen können Ihr ehrenamtliches Engagement für den DSB nicht einschätzen. Können Sie uns beschreiben, wie viel Zeit Sie für das Amt als Vizepräsident investieren müssen?
Sie haben wohl Recht mit dieser Einschätzung. Ich fürchte erst einmal mehr als befürchtet, der Bundeskongress erschöpfte sich in vielen Formalien und Formaldebatten. Das heißt, die verbandsinterne Kommunikation muss erst einmal auf dem Prüfstand, Satzungen verschlanken. Übersichten erstellen, Flyer erstellen und bewerben. Ich rechne mit 1-2 Stunden je Wochentag, eben weil die Verbandsarbeit ja hinzukommt. Aber es macht teilweise und manchmal auch Spaß, z.B. bei den Frauenteammeisterschaften demnächst in Braunfels oder bei Turnieren, die ich mitspielen möchte.
Beim Erreichen welchen Ziels wären Sie mit Ihrer Arbeit persönlich sehr zufrieden?
Mehr Schach an Schulen, ganz unabhängig davon ob es dem Verband sofort nützt! Mehr Frauen und Mädchen im Schach! Mehr Anerkennung für das Schach in Politik und DOSB! Mehr Geld für das Schach von all jenen Firmen, die gerne mit unserem Sport werben! Mehr Leben im Verband! Mehr Vereine mit mehr Leben – von jung bis alt mit Spaß am Schach!
Das Interview führte Carsten Karthaus. Vielen Dank an Uwe Pfenning für das Interview.